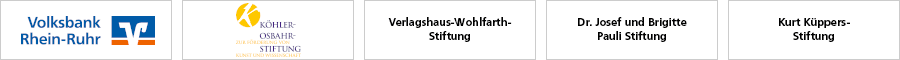Komponieren unter dem Radar
Die 15 Streichquartette von Dmitri Schostakowitsch
Gohrisch ist ein kleiner Kurort in der sächsischen Schweiz, gut 40 Kilometer südöstlich von Dresden. Der Ministerrat der DDR unterhielt in dem idyllischen Städtchen ein feudales Gästehaus, in dem 1960 auch der Komponist Dmitri Schostakowitsch logierte. Er war hierher gekommen, um an der Musik für den Film „Fünf Tage – fünf Nächte“ zu arbeiten, eine sowjetisch-ostdeutsche Koproduktion über der Evakuierung der Dresdner Kunstschätze durch die Rote Armee im Jahre 1945.
„Der Ort ist von unerhörter Schönheit, ideal zum Komponieren“, schwärmte Schostakowitsch in einem Brief an den Leningrader Theaterwissenschaftler Isaak Glikman. Aber es war nicht etwa der Soundtrack des langatmigen Propagandafilms, zu der ihn die Landschaft inspirierte. Am kleinen nierenförmigen Teich im Innenhof des Gebäudekomplexes (so die Überlieferung) komponierte Schostakowitsch eines seiner bedeutendsten Kammermusikwerke, das Streichquartett Nr. 8 op. 110.
Mit gespaltener Zunge
Die Arbeit an der Filmmusik stockte. „Stattdessen“, so der Komponist in bitter-ironischem Ton, „schrieb ich ein niemandem nützendes und ideologisch verwerfliches Quartett. Ich dachte darüber nach, dass, sollte ich irgendwann einmal sterben, kaum jemand ein Werk schreiben wird, das meinem Andenken gewidmet ist. Deshalb habe ich beschlossen, selbst etwas Derartiges zu schreiben. Man könnte auf seinen Einband auch schreiben: ‚Gewidmet dem Andenken des Komponisten dieses Quartetts‘.“
Auch wenn Schostakowitsch das Quartett offiziell dem „Gedenken an die Opfer des Faschismus und des Krieges“ widmete, ist es ohne Zweifel ein Dokument persönlicher, ja intimer Selbstbetrachtung. Der Komponist zitiert hier ausgiebig aus eigenen Werken; geradezu insistierend kommt immer wieder das aus den Tonbuchstaben seines Namens gebildete Motiv D-Es-C-H vor. Der expressiven Kraft dieser Musik kann man sich kaum entziehen. Es scheint, als habe Schostakowitsch sich hier alles von der Seele geschrieben, was ihn von innen und außen bedrängte.
In seinen großen, auch im westlichen Ausland erfolgreichen Sinfonien konnte er sich nie in vergleichbarer Weise öffnen. Hier sprach der„offizielle“ Schostakowitsch: Die „Fünfte“ mit ihrem (freilich doppelbödigen) Jubel-Finale wurde zum Musterwerk des „sozialistischen Realismus“ erklärt. In der „Siebten“ stellte der Komponist den Aufmarsch der deutschen Nazi-Truppen vor Leningrad in einem Klangbild von brutaler Banalität dar. Im Finale der dem Andenken Lenins gewidmeten zwölften Sinfonie beschwor Schostakowitsch eine revolutionäre „Morgenröte der Menschheit“, an die er im Jahre 1961 kaum mehr geglaubt haben dürfte.

Dmitri Schostakowitsch
Foto: Roger & Renate Rössing, Deutsche Fotothek/Wikimedia (CC BY-SA 3.0 DE)
Vieles in diesen Werken ist Fassade; immer wieder spürt man die Rede mit gespaltener Zunge, die unterschwelligen persönlichen Botschaften unter dem offiziösen Verlautbarungston. In seinen Quartetten äußerte Schostakowitsch sich sehr viel direkter und dezidierter. Hier drohte nicht das grelle Licht der großen Öffentlichkeit; hier blieb er gewissermaßen unter dem Radar der stets misstrauischen sowjetischen Kulturpolitik.
Quartette für die Schublade
15 Streichquartette hat Dmitri Schostakowitsch komponiert, ebenso viele wie Sinfonien. Aber während er als Sinfoniker schon mit 19 Jahren erfolgreich debütierte, war er bei Vollendung seines ersten Streichquartetts bereits 32 Jahre alt. Die ersten drei Quartette, entstanden in den Jahren 1938 bis 1946, zeigen den Komponisten noch unter dem Eindruck großer Vorbilder: Der spielerisch-experimentelle Geist Joseph Haydns hat hier ebenso seine Spuren hinterlassen wie die hoch verdichtete Quartettkunst des späten Beethoven. Auch Anklänge an das romantische Melos in den Quartetten seiner Landsleute Alexander Borodin und Peter Tschaikowsky sind deutlich zu vernehmen.
1948 geriet Schostakowitsch in die Schusslinie der stalinistischen Kulturpolitik. Er wurde wegen angeblich „formalistischer“ und „antidemokratischer“ Züge in seiner Musik öffentlich kritisiert und verlor zeitweise seine Professur am Leningrader Konservatorium. Der Komponist ging in die Defensive: Werke, die öffentlichen Unmut erregen könnten, hielt er in den folgenden Jahren konsequent in der Schublade. Darunter war auch das Streichquartett Nr. 4, das weniger aufgrund „modernistischer“ Tendenzen in den Fokus hätte rücken können als wegen der Verwendung jüdischer Folklore – der paranoide Antisemitismus des Diktators Josef Stalin war allgemein bekannt. Das 1951 komponierte Streichquartett Nr. 5 wiederum spiegelte Schostakowitschs Auseinandersetzung mit dem Strukturdenken der westlichen Avantgarde. Auch hier drohte unmittelbare Gefahr.

Dmitri Schostakowitsch bei der Arbeit an einer Partitur (vermutlich die Leningrader Sinfonie), ca. 1940
Foto: Lebrecht Music & Arts / Alamy Stock Photo
Beide Werke kamen erst nach dem Tode Stalins im Jahre 1953 zur Uraufführung. Vor dem Hintergrund der „Tauwetter-Periode“ unter Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow wuchsen dem Komponisten wieder größere Freiheiten zu. Mehr und mehr wurden seine Quartette nun auch zum Spiegel der eigenen Biographie: Das Streichquartett Nr. 7 ist ein erschütterndes Requiem für seine 1954 verstorbene Ehefrau Nina Warsar; das deutlich optimistischer gestimmte neunte ist Irina Supinskaja gewidmet, die (nach einer gescheiterten zweiten Ehe) 1962 Schostakowitschs dritte Ehefrau wurde.
Hermetische Innenwelt
Mitte der sechziger Jahre begann sich Schostakowitschs Quartettstil noch einmal grundlegend zu wandeln. Ebenso wie die 14. und 15. Sinfonie sind auch die letzten fünf Quartette Dokumente des Rückzugs, des Zweifels, der Resignation. Das Vertrauen in die Bindekräfte der musikalischen Tradition schwindet; die klassische vierstimmige Satzstruktur scheint dem Komponisten unter den Händen zu zerrinnen. Oft ragen nur noch einzelne emotional aufgeladene Linien in den Raum. Es ist eine faszinierend spröde, eigenwillige Musik, die allen äußeren Schmuck abgelegt und sich in eine hermetische Seelen-Innenwelt zurückgezogen hat.
Existentielle Wucht
Vorläufer all dieser kritisch kommentierenden und alte Hörgewohnheiten aufbrechenden Versionen ist fraglos Hans Zenders „komponierte Interpretation“ der „Winterreise“, die 1993 in Frankfurt aus der Taufe gehoben wurde. Schon die Kammerorchester-Besetzung mit hohem Schlagzeug-Anteil löst das Werk aus der zuweilen etwas hermetisch wirkenden Intimität des Liederabends. Zenders Version bringt verborgene Stimmen ans Licht, schafft Raumwirkungen, macht in Schuberts Notentext auf faszinierende Weise Zukünftiges hörbar. Bruckner und Mahler, ja sogar Schönberg und Webern kündigen sich an: Romantik aus dem Geist der Avantgarde.
Dieser Ansatz erklärt sich natürlich auch aus Zenders „Doppelexistenz“ als Komponist und Dirigent. Skeptisch gegenüber der Idee einer „texttreuen“ Interpretation macht der 2019 gestorbene Musiker seine ganz eigene Perspektive auf das Werk hörbar, protokolliert seinen persönlichen Prozess der Aneignung und Auseinandersetzung in klingender Form.
Zugleich rückt er damit auch das radikal Neue und Revolutionäre der „Winterreise“ in den Fokus. „Es wird berichtet“, so schreibt Zender, „dass Schubert während der Komposition dieser Lieder nur selten und sehr verstört bei seinen Freunden erschien. Die ersten Aufführungen müssen eher Schrecken als Wohlgefallen ausgelöst haben. Wird es möglich sein, die ästhetische Routine unserer Klassiker-Rezeption, welche solche Erlebnisse fast unmöglich gemacht hat, zu durchbrechen, um eben diese Urimpulse, diese existentielle Wucht des Originals neu zu erleben?“
Nicht nur gesundheitliche Probleme machten Schostakowitsch zunehmend zu schaffen; er hatte auch den Verlust guter Freunde und langjähriger Partner zu beklagen. 1965 starb Wassily Shirinsky, der zweite Geiger des Moskauer Beethoven-Quartetts, das fast alle seine Quartette aus der Taufe gehoben hatte. 1974 musste der Komponist auch Shirinskys Halbbruder Sergej begraben, den Cellisten des Quartetts. „Um mich kreist der Tod“, klagte Schostakowitsch, „einen nach dem andern nimmt er mir, nahestehende und teure Menschen, Kollegen aus der Jugendzeit.“
Das Sergej Shirinsky gewidmete Streichquartett Nr. 15 ist ein einziger, in sechs nahtlos verbundene Sätze gegliederter Trauergesang. „Das ganze Werk verfügt über kein einziges heiteres Element“, schrieb der polnische Komponist und Schostakowitsch-Biograph Krzysztof Meyer. „Auf bewundernswerte Weise verstand es der Künstler, ein 35-minütiges großes Adagio zu schaffen, das den Zuhörer von der ersten bis zur letzten Note fesselt und in Spannung hält.“
Die Uraufführung am 14. November 1974 war einer der letzten Höhepunkte im künstlerischen Leben des bereits schwerkranken Komponisten. Nur zwei Liederzyklen und die großartige Bratschen-Sonate op. 147 sollte er danach noch komponieren. Am 9. August 1975 starb er in Moskau.
Schostakowitsch Streichquartett-Zyklus
Sämtliche Streichquartette in vier Tagen
Mandelring Quartett
Do 04.11.2021, 19.30 Uhr | Lehmbruck Museum
1. Quartett C-Dur op. 49
2. Quartett A-Dur op. 68
4. Quartett D-Dur op. 83
Fr 05.11.2021, 19.30 Uhr | Kulturforum Franziskanerkloster, Kempen
3. Quartett F-Dur op. 73
6. Quartett G-Dur op. 101
8. Quartett c-Moll op. 110
Sa 06.11.2021, 19.30 Uhr | Lehmbruck Museum
5. Quartett B-Dur op. 92
7. Quartett fis-Moll op. 108
9. Quartett Es-Dur op. 117
So 07.11.2021, 11.00 Uhr | Kulturforum Franziskanerkloster, Kempen
10. Quartett As-Dur op. 118
12. Quartett Des-Dur op. 133
14. Quartett Fis-Dur op. 142
So 07.11.2021, 17.00 Uhr | Lehmbruck Museum
11. Quartett f-Moll op. 122
13. Quartett b-Moll op. 138
15. Quartett es-Moll op. 144

Dmitri Schostakowitsch 1943
Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo
Kopfbild: Dmitri Schostakowitsch und das Beethoven-Quartett, November 1973
Foto: SPUTNIK / Alamy Stock Photo